|
|

|
Liebe(r) Newsletter Abonnent,
|
|
die anstehenden Entscheidungen unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft werden Europa auf Jahre hinaus prägen. Es sind entscheidende Wochen und Monate für unsere gemeinsame Zukunft und unseren Wohlstand. Unser erklärtes Ziel ist und bleibt ein neues Maß an politischer und wirtschaftlicher Souveränität Europas. Dabei folgen wir dem Grundsatz, dass europäische Solidarität und Solidität langfristig nur als schlagkräftige Einheit funktionieren können.
|
|
|
|
Fehmarnbeltquerung: 232 Millionen Euro für übergesetzlichen Lärmschutz
|
|
Beim Lärmschutz für die Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung folgt der Bund in weiten Teilen den Wünschen der Region. Diese wurden über Jahre und teils mühsam in einem fortwährenden Dialog mit dem Projektbeirat des FBQ-Dialogforums und der Deutschen Bahn erarbeitet. Der Bundestag hat nun die dafür notwendigen Haushaltsmittel bewilligt. Damit wird ein Meilenstein für eine menschenfreundliche Realisierung der Hinterland-Anbindung der neuen Beltquerung erreicht.
|
|
Ostholstein bekommt in weiten Teilen einen Lärmschutz, der deutlich über das gesetzliche Maß hinausgeht. Für Schleswig-Holstein ist es großes Glück, dass ein solch kostspieliger Beschluss auch in Zeiten einer Corona-Rekordverschuldung möglich war.
|
|
Im Verkehrsausschuss habe ich an vorderster Front den Antrag mitverhandelt. Als Schleswig-Holsteiner habe ich die Forderungen nach übergesetzlichem Lärmschutz besonders gefördert.
|
Große Infrastrukturprojekte – das zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre – brauchen zunehmend eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Bei der Hinterland-Anbindung der Festen Fehmarnbeltquerung nimmt der Bund sehr viel mehr Geld in die Hand als gesetzlich notwendig, um diese Akzeptanz herzustellen. Auch wenn wir nicht alle Wünsche vollumfänglich umsetzen konnten, sehe ich uns mit dieser wichtigen Entscheidung für die Menschen in Ostholstein und Lübeck auf dem richtigen Weg.
|
|
Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
|
|
Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020
|
|
Wir haben mit dem zweiten Nachtragshaushalt eine Erhöhung der Nettokreditaufnahme um 62,5 Mrd. Euro auf 218,5 Mrd. Euro verabschiedet. Mit dem Nachtragshaushalt werden haushaltswirksame Maßnahmen zur Umsetzung des vom Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 beschlossenen Konjunkturpaketes in Gesamtvolumen von 103 Mrd. Euro abgebildet. Außerdem werden Mehrausgaben aus der ,,Corona-Vorsorge“ in Höhe von rd. 14 Mrd. Euro in den Einzelplänen veranschlagt und weitere Steuermindereinnahmen auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2020 in Höhe von rd. 7 Mrd. Euro berücksichtigt.
|
|
|
|
|
|
Grundrente
|
Wir haben die Einführung einer Grundrente sowie Freibeträge in der Grundsicherung und Verbesserungen beim Wohngeld beschlossen. Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente wird ein wichtiges Koalitionsanliegen umgesetzt. Das ist ein Erfolg, nachdem ähnliche Vorhaben in den vorangegangenen Wahlperioden gescheitert waren. Es ist aber auch ein Kompromiss, in welchem sich beide Koalitionspartner wiederfinden und bei dem sich nicht alle Wünsche haben durchsetzen lassen.
|
Mit der Grundrente werden geringe Verdienste mit einem Zuschlag künftig rentenrechtlich stärker aufgewertet. Voraussetzung für den vollen Zuschlag in der Rente sind 35 Jahre Beitragsjahre Grundrentenzeiten, d.h. Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung. Einen reduzierten Zuschlag können Berechtigte bereits ab 33 Jahren Grundrentenzeiten erhalten. Einkommen oberhalb eines Einkommensfreibetrags werden auf die Grundrente angerechnet. Die Zahlung des Zuschlags erfolgt automatisch, ein Antrag ist also nicht erforderlich.
|
Das Grundrentengesetz bedeutet für die Verwaltung einen enormen Kraftakt, da nicht nur die Neurentner ab 1. Januar 2021 von der Grundrente profitieren sollen, sondern auch einige der Millionen Bestandsrentner. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 2021 werden deshalb nicht sofort sämtliche Berechtigte in den Genuss des Zuschlags kommen können: Die Neurentner werden ihrer Grundrente beginnend ab Juli 2021 erhalten. Die Verwaltung wird die bestehenden Renten sukzessive bis zum 31.Dezember 2022 überprüfen, wobei zunächst die lebensältesten Berechtigten die Grundrente erhalten sollen. Es wird in jedem Fall rückwirkend ab 1. Januar 2021 gezahlt werden.
|
|
Außerdem wird als Anreiz für den Aufbau einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersversorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2.575 Euro der Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144 Euro auf maximal 288 Euro erhöht. Die Einkommensgrenze, bis zu der man den vorgenannten Förderbetrag erhält, wird von derzeit 2.200 Euro auf 2.575 Euro brutto angehoben, wovon potentiell 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren werden. Schließlich wird der Förderhöchstbetrag für den Arbeitgeber von 480 Euro auf 960 Euro verdoppelt.
|
|
|
|
Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen
|
In dieser Woche haben wir außerdem Unterstützungsmaßnahmen für die von der Beendigung der Kohleverstromung betroffenen Reviere und Standorte beschlossen. Das umfassende „Investitionsgesetz Kohleregionen“ regelt in einem ersten Teil Finanzhilfen für die betroffenen Länder. Diese Finanzhilfen sollen über Artikel 104b Grundgesetz für Investitionen in einem Gesamtumfang von bis zu 14 Mrd. Euro bis 2038 bereitgestellt werden. Die Länder leisten hierbei den im Grundgesetz vorgesehenen Eigenanteil. Die Mittel können zur Förderung von Investitionen, etwa in die wirtschaftsnahe Infrastruktur, aber auch den Breitband- und Mobilfunkausbau, zur Verbesserung des Angebots im ÖPNV oder in den Umweltschutz und die Landschaftspflege verwendet werden. Das Gesetz legt fest, in welchem Verhältnis die Reviere hier berücksichtigt werden.
|
Im zweiten Teil des Gesetzes verpflichtet sich der Bund, weitere Maßnahmen zugunsten der Braunkohleregionen mit bis zu 26 Mrd. Euro bis 2038 zu fördern, die in seiner eigenen Zuständigkeit liegen. Zu den Maßnahmen gehören etwa der Ausbau der Infrastruktur für den Schienen- und Straßenverkehr und die Ansiedlung und Verstärkung zahlreicher Forschungseinrichtungen.
|
|
|
|
|
|
Kohleausstiegsgesetz
|
|
Neben dem Strukturstärkungsgesetz haben wir in dieser Woche auch das Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Hier werden zentrale energiepolitische Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung bis spätestens 2038 umgesetzt. Bestandteile sind etwa Regelungen zum Ausstieg aus Steinkohle- und Braunkohleverstromung, Entlastungsmaßnahmen für Stromverbraucher und energieintensive Industrien, eine verbesserte Förderung von hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen sowie der Umstellung von Kohlekraftwerken auf Erdgas und erneuerbare Energien, insbesondere Biomasse, im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes und durch Förderprogramme sowie Regelungen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Ebenfalls ermächtigt das Gesetz die Bundesregierung mit Zustimmung des Deutschen Bundestages zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit den Kraftwerksbetreibern zur Konkretisierung der Einzelheiten der Stilllegungen.
|
|
|
|
Streitpunkt Motorradlärm:
Förderprogramm für Zähl- und Messsäulen gefordert
|
|
Die Frage, wie Motorradlärm wirkungsvoll vermindert und kontrolliert werden kann, war in dieser Woche Thema im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags.
|
Der Bundesrat hatte im Mai 2020 in einer Entschließung den Bundestag aufgefordert, Maßnahmen voranzutreiben, um die Schallbelästiugung durch extralaut „getunte“ Motorräder zu reduzieren.
|
Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, an einschlägig bekannten Stellen die Messung und Anzeige des Motorradlärms oder auch die Zählung der Motorräder vorzunehmen. Den Fahrern muss klar gemacht werden, wie belastend diese rücksichtslose Fahrweise für die Anwohner ist. Häufig fehlt aber dann in den Kommunen das notwendige Geld für so eine Anlage. Wir brauchen deshalb ein Förderprogramm für die Unterstützung der Kommunen bei diesem Thema.
|
|
Die Bundesregierung setzt sich bereits auf internationaler und europäischer Ebene für eine Verschärfung der internationalen Geräuschvorschriften ein. Das betrifft sowohl die Typengenehmigungsverfahren als auch die Produktion. Durch neue Technologien ist ein „tuning“ der Motorräder möglich geworden, das zu weit höherer Geräuschentwicklung führt, als serienmäßig vorgesehen. Solche Manipulationen an der Schalldämpferanlage sollen in Zukunft verboten sein. Überwacht werden soll dies auch nicht mehr durch die Hersteller selbst, sondern durch den TÜV.
|
Auch verschärfte Kontrollen mit Dezibelmessungen – analog zu Geschwindigkeitsmessungen – sind ein denkbares Mittel zur Lärmreduktion.
|
Besonders die bergigen, landschaftlich häufig sehr schönen Gegenden Deutschlands sind von dem Problem stark betroffen. Hier werden weitergehende Maßnahmen als bisher gebraucht, die den Motorradlärm reduzieren. Gleichzeitig würde ein generelles Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen über das Ziel hinaus schießen. Die Mehrzahl der Motorradfahrer verhält sich gesetzestreu und rücksichtsvoll. Wichtig ist es daher, einen Ausgleich zu finden zwischen Lärm- und Gesundheitsschutz auf der einen Seite sowie dem Freizeit- und Fahrvergnügen der Motorradfahrer auf der anderen Seite.
|
|
Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
|
|
|
|
Bei einem Anliegen können Sie mich gerne per E-Mail (gero.storjohann@bundestag.de) kontaktieren.
|
|
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und schöne Ferien!
|
|
|
|
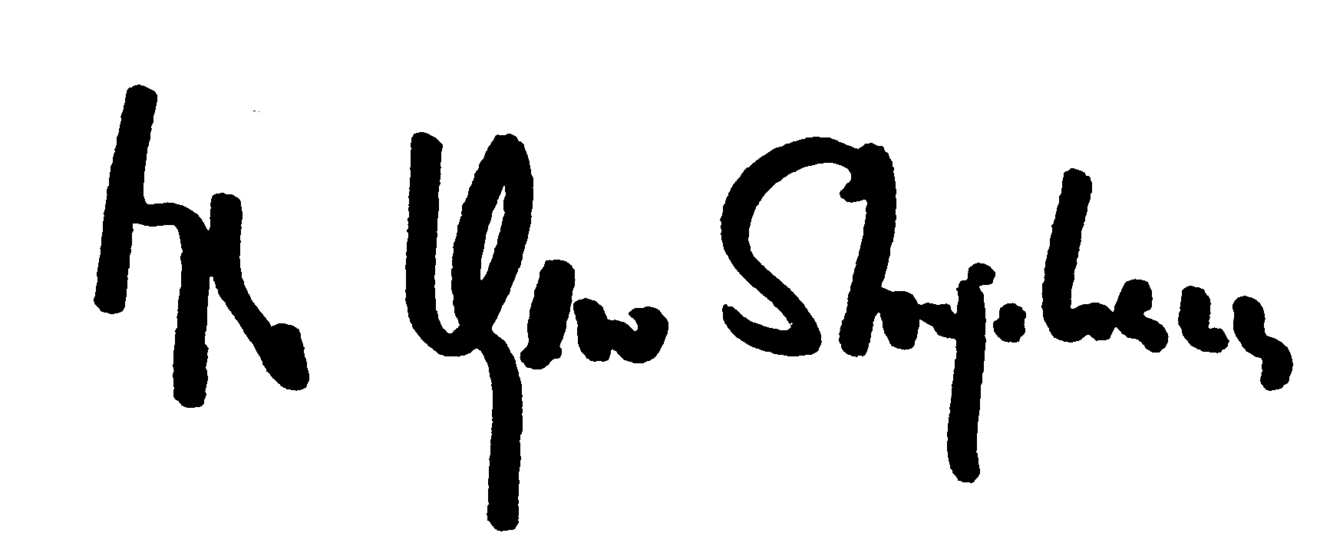
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|